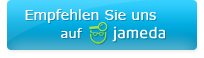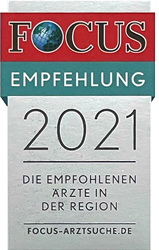Elektrophysiologische Untersuchungsmethoden
Unter elektrophysiologischer Diagnostik versteht man Untersuchungsmethoden, bei denen durch Messung elektrischer Körperströmen Funktionssysteme des Nervensystems (wie Sehen, Bewegung) beurteilt werden können. Die am Schädel, an den Nerven oder in der Muskulatur gemessenen elektrischen Spannungen werden entweder spontan oder durch willkürliche Bewegungen vom Körper erzeugt oder aber durch spezifische Reize (z. B. Töne, kurze Stromreize) im Körper ausgelöst.
Neben den bildgebenden Verfahren wie Computer- und Kernspintomographie sowie den Laboruntersuchungen einschließlich der Untersuchung des Nervenwassers (Liquor cerebrospinalis) stellen die neurophysiologischen Untersuchungsmethoden den dritten Pfeiler der neurologischen Diagnostik dar.
Nervenleitgeschwindigkeit (NLG)
Die Messung der sensiblen und motorischen Nervenleitgeschwindigkeiten (NLG).
Bei der Messung der Nervenleitgeschwindigkeit werden motorische (für die Körperbewegungen zuständige) und sensible (für die Leitung des Gefühls zuständige) Nerven an Armen und Beinen mit Strom gereizt.
Bei der motorischen Messung wird ein Stromreiz an einem Nerv gesetzt, der Nerv wird erregt und leitet den Impuls bis zum Muskel weiter, wo über auf den Muskel gesetzte Ableitelektroden die Reizantwort gemessen werden kann. Zur Bestimmung der motorischen Nervenleitgeschwindigkeit sind immer 2 Reize an unterschiedlichen Stellen des Nervs notwendig.
Bei der sensiblen Nervenleitgeschwindigkeitsmessung werden elektrische Reize am Nerv gesetzt, von diesem weiter geleitet und an anderer Stelle wieder über den Nerv gemessen.
Diese Untersuchungsmethoden werden bei Nervenverletzungen, Druckschäden von Nerven, Polyneuropathien etc. eingesetzt. Dabei werden die Informationen über s. g. neuromuskulären Übertragung zur Verfügung gestellt, durch die Aussagen über Erkrankungen der Nervenwurzeln im Rückenmarkskanal (z. B. bei Bandscheibenvorfällen) und Erkrankungen an der Schnittstelle zwischen Nerv und Muskulatur (Myasthenie, Lambert-Eaton-Syndrom) getroffen werden können.
Elektromyographie (EMG)
Bei der Elektromyographie wird eine Nadel in einen Muskel eingeführt und in verschiedenen Funktionszuständen (in Ruhe, bei leichter Anspannung und bei maximaler Anspannung) die vom Muskel produzierte elektrische Spannung gemessen. Durch Untersuchung verschiedener Muskeln und Muskelgruppen können hier sehr differenzierte Aussagen über Muskelerkrankungen (sog. Myopathien) getroffen werden. Da die Produktion elektrischer Aktivität in der Muskulatur von der Nervenversorgung abhängt, lassen sich mit dem EMG ebenso Erkrankungen von Nerven und Nervenwurzeln gut diagnostizieren.
Evozierte Potentiale
Die Messung von durch spezifischen Reizen (akustisch, optisch, elektrische Hautreize) erzeugten Hirnströmen und die Messung von durch elektrischer Reizung der Hirnrinde erzeugten Muskelkontraktionen (Magnetisch evozierte Potentiale).
Akustisch evozierte Potentiale
Hierbei werden in schneller Abfolge kurze Töne über einen Kopfhörer auf das Innenohr gegeben und dadurch der Gehörnerv in spezifischer Weise gereizt. Durch auf der Schädeloberfläche aufgebrachte Elektroden können dann elektrische Spannungen gemessen werden, die Aussagen über die Funktionsfähigkeit des Gehörnervs sowie der Hörbahnen im unteren und mittleren Hirnstamm (unterer Bereich des Gehirns) zulassen.
Diese Untersuchung wird z.B. bei Tumoren des Hörnervs (Akustikusneurinom), bei Multipler Sklerose, bei hypoxischer Hirnschädigung (Folge einer Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff) und anderen Erkrankungen eingesetzt.
Visuell evozierte Potentiale
Analog zu den akustisch evozierten Potentialen werden hier über einen Computermonitor optische Reize auf die Netzhaut gegeben, hierdurch werden die Sehnerven erregt, die die Erregung zum Gehirn weiterleiten. Über an der Schädeloberfläche angebrachte Elektroden können die dadurch erzeugten Hirnströme gemessen und die Funktionsfähigkeit des visuellen (für das Sehen zuständigen) Systems beurteilt werden.
Hierdurch können Funktionsstörungen des visuellen Systems z. B. bei einer Sehnervenentzündung im Rahmen einer Multiplen Sklerose diagnostiziert werden.
Somatosensorisch evozierte Potentiale (SEP)
Durch wiederholte elektrische Reizung von Nerven an Armen und Beinen werden Erregungen produziert, die über Nerven und Rückenmark bis zum Gehirn geleitet und über den Schädel mit Elektroden aufgezeichnet werden können. Hierdurch sind Aussagen über Funktionsstörungen von Nerven, Rückenmark und Gehirn möglich.
Eingesetzt wird diese Untersuchung z.B. bei Multipler Sklerose, Tumoren im Rückenmarksbereich sowie in der Hirntoddiagnostik.
In unserer Praxis werden alle wesentlichen Methoden der neurophysiologischen Funktionsdiagnostik angewendet. Hierfür stehen zwei moderne computergestützte Ableitplätze für evozierte Potentiale einschließlich Funktionsdiagnostik des vegetativen Nervensystems sowie für die Neurographie und die Elektromyographie zur Verfügung.


 01/2024
01/2024